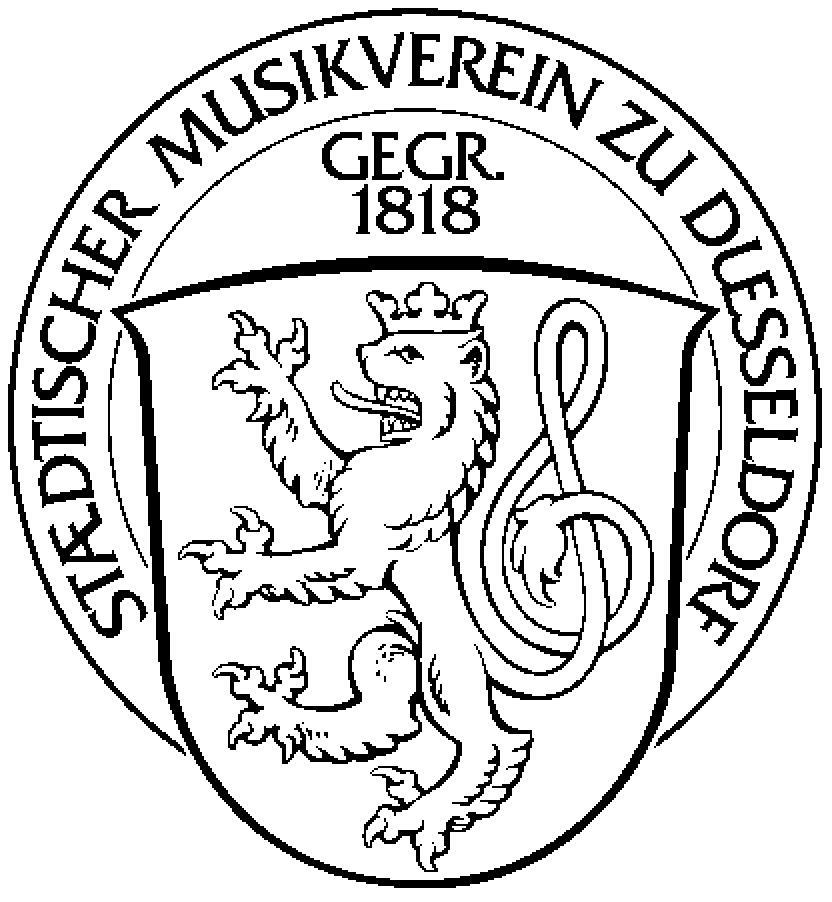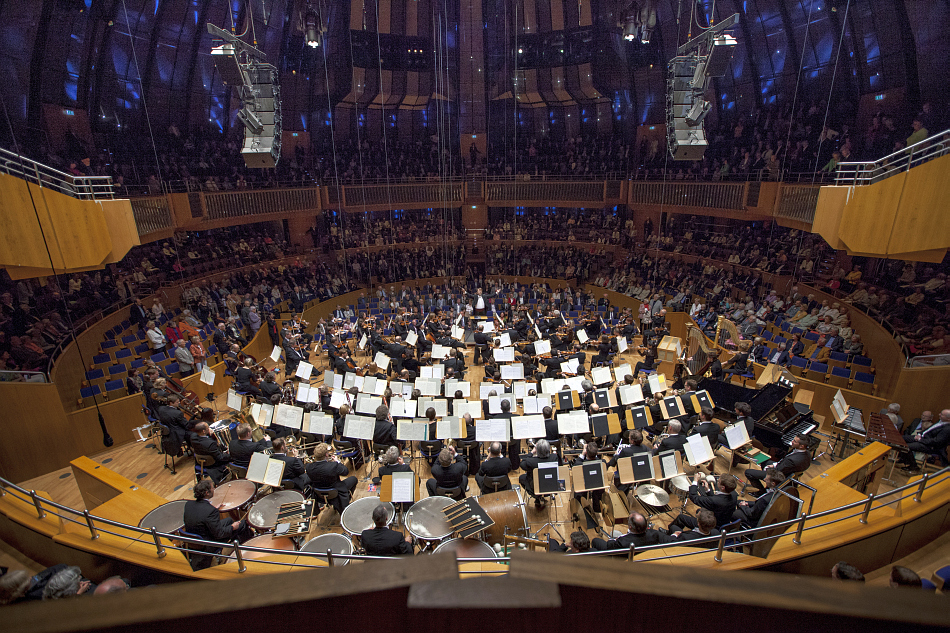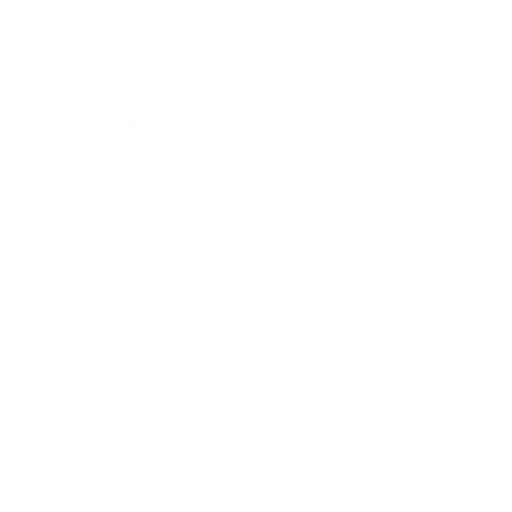In einem Blog stellte die Tonhalle Düsseldorf einen Beitrag ins Netz, die der Autor dieser Chronik hier festhalten möchte. Die erste Dramaturgin Elisabeth von Leliwa und der heutige Dramaturg Dr. Uwe Sommer-Sorgente führen ein Zwiegespräch über einige Jahrzehnte Tonhallen-Geschichte. Diese spannende Entwicklung habe ich als Autor dieser Chronik hautnah miterlebt und diese Zeit ist auch sehr intensiv mit dem Städtischen Musikverein verbunden. Aus diesem Grunde möchte ich ein solch wichtiges Zeitdokument an dieser Stelle festhalten:
Elisabeth von Leliwa war von März 1987 bis März 2012 Dramaturgin an der Tonhalle, ihr Nachfolger Uwe Sommer-Sorgente ist seit November 2012 am Haus. Die beiden haben sich getroffen, um anlässlich des 500. Abo-Programms der Düsseldorfer Symphoniker in der (neuen) Tonhalle die vergangenen Jahrzehnte ganz subjektiv Revue passieren zu lassen: Was hat sich geändert seit 1978, was hat Bestand? Welche Künstlerpersönlichkeiten sind in Erinnerung geblieben, welche Konzert-Highlights?
Uwe Sommer-Sorgente: Wenn Du auf Deine Anfangsjahre an der Tonhalle zurückblickst, auf die damalige Struktur des Hauses und die Konzertreihen – was sind für Dich die größten Unterschiede zu heute?
Elisabeth von Leliwa: Bevor ich an die Tonhalle kam, gab es überhaupt keine Dramaturgenstelle. Bernhard Klee hatte auch keinen Intendanten oder Ähnliches. Er war Generalmusikdirektor und hat mit einer Sekretärin und einem Orchesterdirektor den Laden geschmissen. Da gab es dann 12 Symphoniekonzerte, sechs Sonderkonzerte, acht Kammerkonzerte – und aus die Maus.
USS: Gab es auch damals schon Gastveranstaltungen jenseits der hehren Klassik?
EvL: Dass sich auch Leute in die Tonhalle eingemietet haben, war schon immer und von Anfang an das Geschäftsmodell. Als ich kam, waren die Verwaltungen noch getrennt. Die Tonhallen-Verwaltung war eine gefühlte Einheit für sich, die mit ihrem Mietgeschäft die schwarzen Zahlen einfuhr – und wir mit der künstlerischen Abteilung fuhren die roten. So ist das halt.
USS: Das mit rot und schwarz hat sich graduell vielleicht ein bisschen verändert, aber nicht grundsätzlich. Du gehst ja auch heute noch in die Sternzeichen. Vergleiche da doch mal früher und heute.
EvL: Was sich für mich wirklich verändert hat: Das Orchester ist bunter geworden, in vielerlei Hinsicht. Es ist vom Generationenmix her jünger geworden. Als ich anfing, saßen da viele eher altehrwürdige Herren. Es war sehr männerlastig. Das hat sich dann aber aufgrund einer sich ändernden Gesellschaft und einer anderen Studierendenstruktur relativ schnell geändert. Wenn ich jetzt aufs Podium schaue, freut mich das einfach, wie bunt das Orchester ist: an Charakteren, Köpfen, Haarfarben, Gesichtern, Hautfarben.
USS: Hat sich auch die Spielweise geändert?
EvL: Das ist schwer zu beurteilen. Aber dass das Orchester ab 2005 in einer richtig guten Akustik spielen durfte, hat ihm definitiv einen Schub gegeben und einer stetigen Entwicklung Vorschub geleistet. Man muss ja auch bedenken: Welcher Musiker bewirbt sich bei einem bestimmten Orchester oder nicht?
USS: Sind wegen der schlechten Akustik vor 2005 viele Dirigenten auch einfach nicht gekommen?
EvL: Ja, es sind viele Dirigenten nicht gekommen oder auch im Zorn gegangen. Zum Beispiel ein David Shallon, der sich regelrecht wundgerieben hat an dem Thema. Ich weiß noch, wie ich in der allerersten Probe für das Eröffnungskonzert nach dem Umbau 2005 saß. Im „Staubnebel“, muss man eigentlich sagen: Der Saal war gerade so fertig, dass man ihn bespielen konnte, aber er hatte so einen speziellen Geruch, diesen leichten Nebel, gelegentlich heraushängende Kabel – also den Charme des nicht ganz Fertigen. John Fiore begann die Probe mit Strauss, Heldenleben. Die spielten noch keine Minute, da hatte ich Wasser in den Augen. Und ich bin keine, die schnell im Konzert heult – und schon gar nicht in einer Probe! „Die spielten noch keine Minute, da hatte ich Wasser in den Augen.
USS: Es war bestimmt auch die Trauer darüber, was möglich gewesen wäre, wenn man den Umbau früher gemacht hätte ...
EvL: Die Trauer – aber vor allem das Glück. Ich weiß noch: Nach dem Eröffnungskonzert kam unser damals schon pensionierter Solo-Fagottist Fritz Essmann auf mich zugeschossen und sagte: „Frau von Leliwa, darf ich mit meiner Wurzel kommen und hier einfach nur noch einmal spielen?“ Dieses Emotionale! Du hast in die Gesichter geschaut und merktest: Mit den Leuten passiert etwas. Fiore musste auch abklopfen und sagte: „Ich muss mich jetzt erst mal fassen.“ Das sagt eigentlich schon alles darüber, wie es vorher war. Es war trocken, es gab den Klopfgeist …
USS: Das hat doch sicher das ganze Klima im Haus positiv beeinflusst. Oder war es nur wie ein Feuerwerkskörper, der schnell wieder verglüht?
EvL: Nein, es war ein unbedingt nachhaltiges Ereignis. Es war sicher nicht hinterher alles gut, aber ich glaube: So ein Aufschwung, wie das Orchester jetzt mit Adam Fischer genommen hat, der wäre ohne diesen Urknall gar nicht möglich gewesen.
USS: Sind dann auch im Vermietungsgeschäft über Heinersdorff andere Orchester gekommen, als sie von der neuen Akustik wussten?
EvL: Ja, er hat dann auch einige von den ganz großen amerikanischen Orchestern geholt, die sich ebenfalls sehr positiv geäußert haben. Auch die Optik wurde von allen gerade in den ersten zwei, drei Jahren, als das für viele Gastkünstler noch neu war, unheimlich gelobt – dieser Aha-Effekt, unter dem Sternenhimmel zu spielen. Ein Saal, der schön aussieht und schön klingt, der klingt noch mal schöner als ein Saal, der nur schön klingt. Das ist einfach so.
USS: Die bauliche Veränderung hat also sehr viel Schönes ausgelöst. Wie ist es denn mit dem Künstlerischen? Haben die Programme im Laufe der Jahre eine andere Wendung genommen? Oder ist das Strickmuster noch ähnlich?
EvL: Die haben sich immer verändert. Die Strickmuster sind überhaupt nicht ähnlich. Da hat man immer die Persönlichkeiten der jeweiligen Chefdirigenten, GMDs und Intendanten sehr stark gefühlt.
USS: Und der Dramaturgin möglicherweise...
EvL: Ja, der Dramaturgin möglicherweise auch. (lacht) Wobei man sagen muss, dass ein Chefdirigent und GMD bei den Düsseldorfer Symphonikern schon das „Recht der ersten Geburt“ hatte. Die kommen ja auch mit einem Elan, wenn sie frisch eine GMD-Stelle antreten. Sie stürzen sich natürlich oft auf Repertoire-Stücke, die sie jetzt endlich mal machen dürfen. Als sie noch Kapellmeister waren, hat’s ja immer der Chef gemacht. Aber es sind auch unterschiedliche Temperamente. Nehmen wir zum Beispiel Bernhard Klee. Wenn man die Programmhefte durchschaut, sieht man, dass da jemand eine sehr klare dramaturgische Linie hatte: die deutsche Musikästhetik von Adorno etc., die Linie der ersten und Zweiten Wiener Schule ...
USS: Klee hat den Saal 1978 mit Wolfgang Fortner eröffnet – das war schon mal eine Setzung. Für die er auch mächtig Kritik einstecken musste.
EvL: Genau. Klee hat damals mit viel Musik aus dem 20. Jahrhundert begonnen, die sehr sperrig war – die Zweite Wiener Schule und deren Umfeld –, das hat er immer gut eingestreut. Dann auch die französische Moderne – Debussy, Ravel, Messiaen ...
USS: Was dann ja auch von Mas Conde sehr gepflegt worden ist …
EvL: Ja, genau: das ganze romanische Repertoire. Und als Shallon dann kam, sagte der: „Hier ist ja überhaupt kein Britten, Elgar, Bernstein gespielt worden!“ Dann habe ich gesagt: „Klar, sieh dir den bisherigen Chefdirigenten an – das war nicht seine Musik!“ Und Shallon hat dann den ganzen Bernstein orchestral gemacht. Und die klassische Moderne, etwa Hindemith. Er hat die britische Musik mit hineingebracht. Aber auch Dutilleux, der bis dahin auch nicht gespielt worden war. Shallon kam wirklich und sagte: „Mensch, ich guck mal, was ist denn hier alles nicht gemacht worden – genau das will ich jetzt machen.“ Die Programme wurden dann oft als sehr bunt bezeichnet – das waren sie auch. Es waren nicht mehr diese dramaturgisch durchdachten Programme. Aber für das Publikum ist das oft nicht schlecht.
„Hier ist ja überhaupt kein Britten, Elgar, Bernstein gespielt worden!“
USS: Dieses Bunte passt sicher auch zum gegenwärtigen Zeitgeist. Wobei wir auch heute gerne „dramaturgisch“ denken, wie etwa 2014, als wir ein Spielzeitmotto und viel Musik rund um den Totalitarismus hatten. Und durch Fischers Haydn-Mahler-Zyklus hatten wir in den letzten Jahren quasi automatisch starke Pfosten im Programm.
EvL: Was damals so ein Pfosten in der zeitgenössischen Musik war, kam vor allem vom Intendanten Peter Girth. In seiner Ära kann man die Symphoniekonzerte überhaupt nicht vom Rest des plötzlich neu aufsprudelnden Spielplans denken. Da gab es neben den Abo-Konzerten auf einmal noch 60 bis 70 zusätzliche Konzerte. Er setzte einen ganz starken zeitgenössischen Akzent. Und in den Symphoniekonzerten hat er in jeder Spielzeit einen wirklich herausragenden Komponisten eingeladen, der auch dirigieren konnte. Davon haben wir in der Shallon-Ära sechs Jahre lang gezehrt.
USS: Das war für Dich sicher eine Zeit mit besonders vielen Highlights.
EvL: Auf jeden Fall. Als Penderecki da war und vor allem Lutosławski, das war eine ganz beeindruckende Person. Es war auch jemand wie Henze eingeladen, der ja nicht selber dirigieren konnte, weil er krank war, aber dann einen Dirigenten mitbrachte und selbst zum Konzert kam. Für mich war auch Peter Maxwell Davies sehr prägend. Der kam dann mehrfach, was für mich persönlich wichtig war, weil sich daraus eine Freundschaft entwickelt hat. Dann war aber mit Mas Conde ein GMD da, der zwar diesen ganzen romanischen Raum geöffnet hat, aber sagte: „Ich kann nur moderne Stücke dirigieren, von denen ich hundert Prozent überzeugt bin und von denen ich weiß, dass ich genug Probenzeit habe.“ Ein Highlight mit ihm war für mich ein Stück von Roberto Gerhard, ein katalanischer Komponist, der auch zwölftönig komponiert hat. Der hat Camus‘ „Pest“ als Oratorium vertont – ein ganz, ganz eindrückliches Stück, das mich damals sehr bewegt hat. Was den Chor aber auch sehr gequält hat, weil es natürlich sehr schwer war. Dazu gibt es eine schöne Anekdote: Die Chorsoprane haben Mas Conde eine kleine Ratte aus Teig – in der „Pest“ spielen ja Ratten eine wichtige Rolle – mit Rosinenäuglein und einem Lakritzschwanz gebacken. Die stand dann die ganze Zeit auf Mas Condes großem Schreibtisch. Immer, wenn wir eine Besprechung hatten, guckte ich auf diese Roberto-Gerhard-La-Peste-Ratte.
USS: Wie ist denn diese Pflege von den großen aktuellen Komponisten, die auch dirigiert haben, beim Publikum angekommen?
EvL: Ich hatte das Gefühl, dass das eigentlich ganz gut ankam.
USS: Wurde das vielleicht einfach nur gut vermittelt?
EvL: Nein, das wurde überhaupt nicht vermittelt! Das waren noch die schönen Post-68er-Zeiten, wo man die Kunst machte, und das Volk versteht es oder nicht. Den Satz habe ich wirklich gehört: „Sie haben es wieder nicht verstanden!“ Das war auch gar nicht böse gemeint, damals hat ein künstlerischer Leiter das in tiefer Verzweiflung gesagt. Nun, Vermittlung – da gab es vielleicht mal ein Gespräch. Aber so, wie man das seit etwa Ende der 90er-Jahre immer selbstverständlicher macht, war das damals gar nicht. Man verstand sich schon als Kunsttempel – und mal kam das Publikum, mal nicht. Man muss aber auch einfach sagen: Der Klee hat mit seinen Programmen eine tolle Vorarbeit geleistet, was das Zeitgenössische angeht. Man merkte zwar, dass es dann nicht so voll war wie bei einer Beethoven 9, aber wir haben auch nicht bei Lutosławski plötzlich nur mit 300 Leuten dagesessen, weil niemand zum Abokonzert gekommen wäre.
USS: Heißt das, dass Du in Deiner Arbeit noch nicht so in den Zwiespalt gekommen bist, einerseits tolle Kunst machen zu wollen, sie andererseits aber auch verkaufen zu müssen? Da sind wir als Dramaturgen ja oft dazwischen, was nicht immer ganz einfach ist.
EvL: Ich weigere mich dagegen, dass das ein Zwiespalt ist. Dazu hat der Komponist Oskar Gottlieb Blarr einmal etwas Schönes gesagt. Ich glaube, da haben wir zusammen in der Probe zu Tschaikowskys erstem Klavierkonzert gesessen. „Diese ganz berühmten Stücke sind nicht umsonst so berühmt“, sagte Blarr. „Die haben nämlich eine Qualität, und zwar eine sehr hohe.“ Das heißt: Man braucht sich auch nicht zu schämen, wenn man mal ein bekanntes Stück vermitteln muss. Und sehr oft ist es da ja gerade wiederum die Herausforderung, dass man den Leuten zeigt: Da ist noch viel mehr drin als ihr glaubt zu kennen. Weil diese Stücke eben eine unglaubliche Tiefe haben.
USS: Den Begriff des Marketings gab es damals ja noch gar nicht.
EvL: Nein, das fing erst mit der Intendantin Vera von Hazebrouck an, als wir begannen, in einem Team zu planen. Sie hat versucht, die Runden regelmäßig groß zu machen. Es ist ja zum Beispiel auch sehr wichtig zu hören, was ein Foyerteam zu erzählen hat. Da sollte man sehr genau zuhören. Die sind wirklich am Puls.
USS: Wie auch das Kassenpersonal.
EvL: Ja, gerade an der Kasse erlebt man die Leute, die dann vielleicht nicht mehr kommen. Als Dramaturg oder in den Publikumsgesprächen ist man ja meist mit denen zusammen, die eh schon überzeugt sind. Der Grafiker Uwe van Afferden sagte mal: „Nicht immer die Leute erreichen, die sowieso schon katholisch sind!“ Dieses Zuhören nach draußen haben wir damals eingeführt, unter einer Intendantin, die extrem Marketing-orientiert war, die aber auch eine ganz große Leidenschaft für Musik hatte und nie etwas anderes hätte verkaufen wollen. Da habe ich sehr viel gelernt. Das war für mich ein großer Schub weg von dem früheren „Na, sie verstehen es wieder nicht“.
USS: Hat sich das Publikum über die Jahre verändert?
EvL: Eine ganz schwierige Frage. Das ist etwas, das man eigentlich statistisch sauber erheben müsste. Meine gefühlte Wahrheit wäre, dass sich das Publikum ein kleines bisschen verjüngt hat in bestimmten Bereichen. Aber dass natürlich für ein bestimmtes Klassik-Repertoire das Publikum schon seit jeher ein bisschen älter war. Ich habe in meinen Dramaturgenzeiten immer gerne in der Vermittlung ein Bild des französischen Malers Honoré Daumier aus dem 19. Jahrhundert gezeigt: Leute in einem Pariser Konzert, alles ältere Menschen.
USS: Ich habe das Gefühl, dass sich das Publikum wenig verändert hat. Im Vergleich zu allem anderen. Auf der Bühne hat sich mehr verändert als im Saal.
EvL: Das sehe ich auch so. Aber womit arbeiten wir denn auch? Mit einer Bevölkerungspyramide in einer überalterten und immer älter werdenden Gesellschaft. Und jetzt nehmen wir doch mal junge Familien, wie die Leute sich da abstrampeln. Da gehe ich dann doch nicht noch abends ins Konzert und brauche bis 11 Uhr abends, bis ich zu Hause bin, und hole um 6 Uhr morgens wieder meine Kinder aus dem Bett ...
USS: Wir machen natürlich viel mehr Vermittlungsangebote als früher, bieten auch mehr an für bestimmte Zielgruppen. So federn wir das ein bisschen ab.
„Das Konzertpublikum stirbt nicht aus!“
EvL: Man sollte aber auch das Publikum so nehmen, wie es ist, finde ich. Junges Publikum ist ja jetzt nicht besser als älteres Publikum. Und: In den späten 80er-, frühen 90er-Jahren waren doch die Schlagzeilen: „Das Konzertpublikum stirbt aus!“ Und das tut es ja eben gar nicht. Das heißt, die Vermittlung hat funktioniert. Weil die Leute, die damals 20 oder 30 waren und ein paar Mal gekommen sind, jetzt nämlich häufiger kommen – wenn sie vielleicht in Rente sind oder die Kinder aus dem Haus.
USS: Das sind aber auch diese typischen deutschen Teufel, die an die Wand gemalt werden.
EvL: Ganz genau. Und erinnern wir uns doch an diese Untersuchungen vom Ende der 2000er-Jahre, wo gezeigt wurde, dass eine Steigerung der Konzertzahlen erfolgt ist, aber dass der Hauptteil des Publikums plus 50 oder plus 60 ist. Das heißt: Dieses Publikum hat nach mehr Konzerten verlangt.
USS: Und noch immer gehen mehr ins Konzert als in die Stadien.
EvL: Richtig. Und sowas wie Kinderkonzerte oder Jugendprogramme, die macht man auch nicht dafür, dass die jungen Menschen später wiederkommen, sondern dafür, dass sie jetzt da sind. Das ist auch ein neues Denken in puncto Dienstleistung. Dass ich einfach schaue: Es gibt eine große Stadtgesellschaft – was mache ich für bestimmte Leute?
USS: Noch mal zurück zu Deiner Geschichte: Was waren denn sonst noch deine Highlights in den Sternzeichen?
EvL: Da gibt es einiges… Ich habe mich in Vorbereitung auf unser Gespräch länger damit beschäftigt. Das war eine schöne, sehr persönliche Zeitreise. Was mich am Ende dann sehr überrascht hat: Diese großen oratorischen Sachen sind irgendwie als besondere Ereignisse hängengeblieben. Das liegt zum einen an den Künstlerpersönlichkeiten, die einen bei solchen Projekten besuchen. Zum anderen gab es aber auch etwas, das dann weitergearbeitet hat in mir selbst. Das war zum Beispiel bei Shallon der Fall, der ein großer Berlioz-Fan war, was ich überhaupt nicht bin. Der hat die „Symphonie fantastique“ mit „Lélio“, dem Folgestück, kombiniert. Das war noch in der alten Akustik der Tonhalle, wo Paul-Émile Deiber, ein französischer Schauspieler alter Schule, der von der Comédie française kam, sich auf den Paukenplatz stellte und den Text des „Lélio“ ohne Mikrofon so rezitierte, dass man ihn noch in der letzten Reihe hören konnte. Und dazu diese Musik – das war damals ein Riesenerlebnis. Ein echtes Highlight war auch Schumanns „Manfred“, von Johannes Deutsch inszeniert, mit Johann von Bülow und Andrey Boreyko. Wo von Bülow als „Manfred“ in einer Kugel in der Kuppel über den Zuhörern schwebte. Und das alles in der neuen Tonhalle. Gerade in Düsseldorf dieses verkannte Schumann-Stück neu zu fassen, von dem ich bis dahin immer dachte, naja, da hat sich Schumann irgendwie vergaloppiert …
USS: Hängt für dich eigentlich so ein Schumann-Duft in der Halle?
EvL: Ja, es wird schon viel Schumann-Pflege betrieben, natürlich auch im Rahmen der Schumannfeste. Mas Conde ist mir gerade mit Schumann in Erinnerung. Zum Beispiel ein ganz normales Abo-Konzert, wo für mich immer noch so eine Schumann 2 herausleuchtet, die irgendwie besonders war. Oder auch dieses schöne Schumann-Jahr 2010, was Michael Becker damals zu meiner großen Arbeit, aber auch zu meinem großen Vergnügen gemacht hat – den ganzen Schumann, was wir fast geschafft haben, bis auf ein paar versprengte Chorsachen. Ja, es hängt ein Schumann-Duft in der Luft. Der auch für viele Highlights gesorgt hat. „Es hängt ein Schumann-Duft in der Luft.“
USS: Wo haben die Düsseldorfer Symphoniker in Deinen Jahren ihre besondere Klasse gezeigt?
EvL: Das Orchester war schon immer, auch in der schlechten Akustik, ein tolles Orchester für Spätromantik und klassische Moderne. Strauss und Schostakowitsch, das waren oft herausragende Highlights, auch mit Gastdirigenten. 1995 hat Nikolaus Trieb mehr oder weniger als sein Einstandskonzert das 2. Cellokonzert von Schostakowitsch gespielt. Das war für mich ein ganz, ganz eindrückliches Schostakowitsch-Initiationserlebnis. Und Carl St. Clair hat die Fünfte dirigiert, da hat Ruth Legelli wunderbar das Flötensolo gespielt.
USS: Und Mahler?
EvL: Da gab es einen sehr schönen Staffelwechsel zwischen Klee und Shallon: Klee hörte mit der Auferstehungssymphonie auf – was ich ganz schön finde, wenn man mit einem so positiven Stück aufhört –, und Shallon sagte: „Dann fange ich mit Mahler 3 an!“ Der hat das bewusst gemacht.
USS: Und stilistisch wahrscheinlich ziemlich anders, oder?
EvL: Ja, natürlich! Shallon hatte ein unglaubliches Temperament. Er war ja auch Assistent von Bernstein. Hier war seine erste große Chefstelle. Er musste, glaube ich, auch für sich selber noch diesen Sprung von jungem Feuer zu einem deutschen TVK-Orchester schaffen.
USS: Für mich waren in den zurückliegenden Jahren auch vor allem die Konzerte mit spätromantischem Repertoire unter einigen Dirigenten die Sternstunden – Inbal zum Beispiel, Asher Fisch, Alexandre Bloch. Und dann natürlich, als Adam Fischer kam, der Mahler-Zyklus. Aber eigentlich noch mehr als Initialzündung der Haydn. Es war eine Offenbarung, als Fischer das erste Mal einen Haydn gemacht hat und aus diesem Orchester, das bis dahin einen eher uncharismatischen Haydn gespielt hatte, wirklich Unglaubliches rausgeholt hat. Es war wie eine Frischzellenkur, alle saßen auf der Stuhlkante und haben diese Musik zum Glühen gebracht, zum Tanzen und zum Lachen. Und das hat sich gehalten, das war keine Eintagsfliege. Das hat ausgestrahlt auch auf andere Komponisten, andere Musiken.
EvL: Das ist vielleicht die beste Schule, für ein Orchester – und für die Zuhörenden. Ich halte Haydn für den unterschätztesten großen Meister.
USS: Absolut. Für mich war es ein tolles Erlebnis, dass das Orchester, das ja auch eine amorphe, träge Masse sein kann, auf einmal so in Bewegung gerät. Und das hat Adam Fischer geschafft, das haben aber auch die Musiker selber geschafft – das liegt nicht nur am Dirigenten. Da ist auch eine große Offenheit.
EvL: Ja, das muss man auch wollen.
USS: Das hängt vielleicht auch wieder mit der Buntheit des Orchesters zusammen.
EvL: Mit Sicherheit auch mit den Erfahrungen. Man darf ja nicht vergessen, dass jüngere Musiker, die jetzt ins Orchester kommen, in ihrem Studium von historischer Aufführungspraxis zumindest auch mal gehört haben.
USS: Oder es kommt ein Bassam Mussad, der beim West-Eastern Divan Orchestra spielt und einen ganz anderen Approach zur Musik mitbringt.
EvL: Natürlich kommen da andere Musiziertraditionen hinein, die es früher gar nicht gab. Die Kolleginnen und Kollegen, die 40 oder 50 Jahre alt waren, als ich ins Orchester kam, die hätten gar nicht die Chance zu einer solchen Offenheit haben können.
USS: Oder nehmen wir unseren Konzertmeister Dragos Manza, der initiiert hat, mit den DüSy Mendelssohns Streichersymphonien „historisch informiert“ zu machen. Da ist viel Engagement.
EvL: Solche Initiativen gab es immer schon. Ich erinnere mich an den mittlerweile verstorbenen Cellisten der Symphoniker, Alfred Lessing, der war einer der Pioniere des historischen Instrumentenbaus und der Alten Musik in Deutschland. Aber das war natürlich streng getrennt vom Orchesterspiel. Und Lessing war dann sehr froh, als jemand wie Peter Girth kam, der ihm eine Spielwiese für seine Sachen gab. Girth hat auch – das war in seiner ersten eigenen Spielzeit – einen Haydn-Kammermusik-Zyklus gemacht. Da schließt sich vielleicht der Kreis, und man sieht, wie visionär der Girth war. Der Zyklus war eine meiner ersten dramaturgischen Aufgaben, da durfte ich auch Vorschläge machen: „Machen Sie mal, Leli!“ Das hat super viel Spaß gemacht, schon wegen der großen Bandbreite an Kammermusik, von der das meiste ziemlich unbekannt war. Damals einen Haydn-Zyklus zu machen – das ist schon eine Ansage!
USS: Für mich war auch Bernsteins „Mass“ ein wirklicher Höhepunkt. Zu merken, dass man es schafft, in einem Haus, das eigentlich gar nicht dafür gebaut ist, so ein Spektakel erfolgreich auf die Bühne zu bringen. Natürlich mit viel kräftezehrender Arbeit in jeglicher, auch ökonomischer Hinsicht. Die Aufführung wurde zu einem Fest, viele hatten Gänsehaut, es ist auf der Bühne und im Publikum ein echter Flow entstanden.
EvL: Das ist das Schönste an unserer Arbeit: Das Zusammenwirken an einem Gesamtkunstwerk, das dem Publikum, den Mitwirkenden und dem Team ganz besondere Erlebnisse beschert
Dokumentation: Marita Ingenhoven-Tonhalle Düsseldorf im November 2019