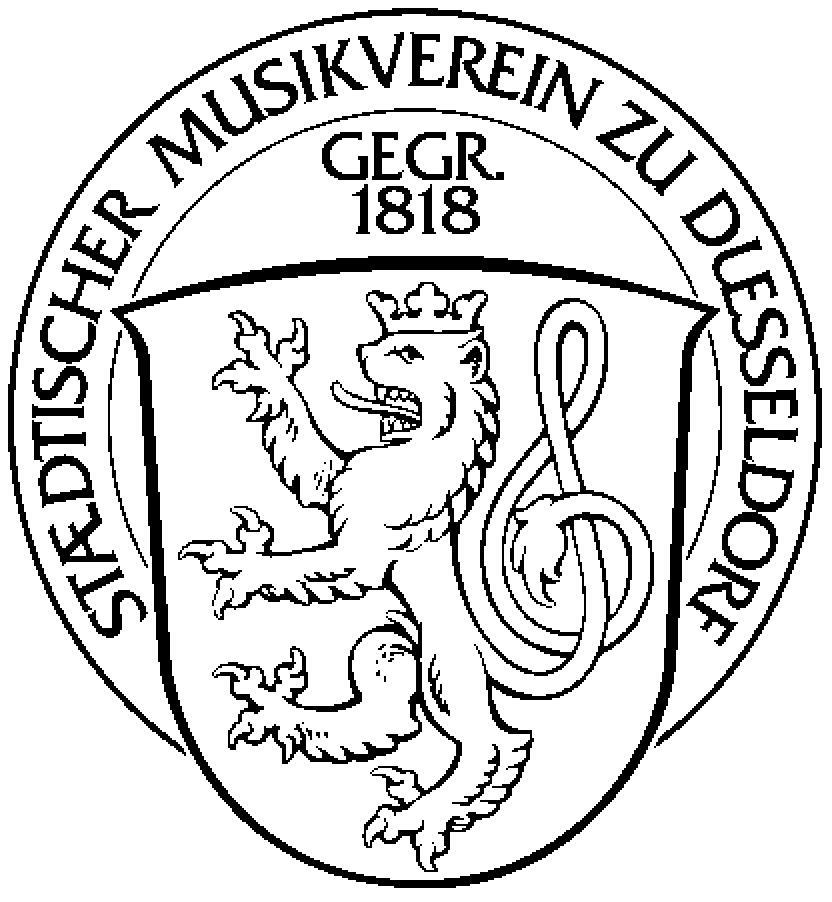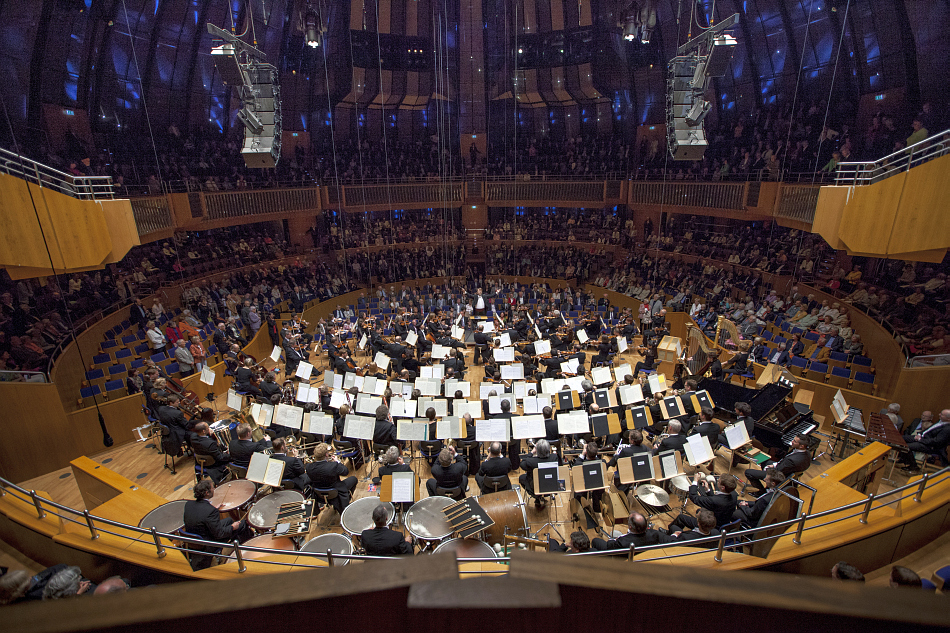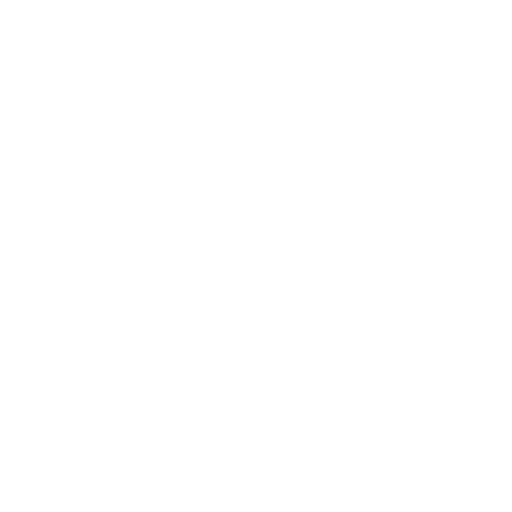Schaut man ins Internet, aber auch in die örtliche Düsseldorfer Zeitung Rheinische Post, stellt man fest, dass das Buch von Christine Eichel
„CLARA: Künstlerin, Karrierefrau, Working Mom“
ein vielfältiges Echo erfährt und jubelnde Rezensionen auslöst.
Als Ehrenvorsitzender des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e.V. gegr. 1818, der sich über Jahrzehnte um das Düsseldorfer Erbe der Familie Schumann gekümmert hat, bin ich etwas in Sorge, dass das nicht nur vom Musikverein geschätzte und in der Musikgeschichte einzigartige Ehepaar Schumann verunglimpft und in ein Licht gestellt wird, welches nicht den belegbaren Fakten entspricht.
Meine Sorge bezieht sich aber auch darauf, dass es den Anschein hat, dass man lustig Fake-News verbreitet und damit die seriöse Musikwissenschaft und deren Arbeit – in diesem Fall speziell diejenigen, die seit Jahrzehnten zur Familie Schumann forschen – ins vorige Jahrhundert zurückgeworfen wird.
Nun bin ich kein Musikwissenschaftler und würde mir nicht erlauben, im Stande des „letzten Wissens“ zu sein, meine aber schon, dass man sich in seriöser Weise diesem großartigen Künstlerpaar nähern müsste und dabei die heutige Beurteilung deren Lebens nicht den Blick auf die Realitäten der damaligen Welt verstellen sollte. Beim Umgang mit solch großen Künstlerpersönlichkeiten steht in meinem Verständnis immer die Liebe zu deren Lebensleistung im Vordergrund.
Unter „seriöser Weise“ verstehe ich korrekte und korrekt recherchierte Quellenangaben, die ich in diesem Buch in besonderer Weise vermisse.
Ein kleines Beispiel hierzu:
- Die Autorin verwendet alte, zum Teil längst überholte Ausgaben mit Briefen von Clara und Robert Schumann, nicht aber die seit 2008 erscheinende, fast schon vollendete Schumann-Briefedition, hier insbesondere auch den für die Thematik so entscheidenden Braut-Briefwechsel.
Belegstellen für echte Quellen vermisst man ohnehin. Frau Eichel gibt unter „Quellen mit Siglen“ Sekundärliteratur an.
Als „Gestützt auf bisher unbeachtete Quellen“ wird das Buch vollmundig beworben. Auf Nachfrage: renommierten Schumann-Forscherinnen und -Forschern sind diese im Rahmen ihrer jahrzehntelangen Arbeit nicht aufgefallen. Merkwürdigerweise tauchen diese tollen Quellen im Buchinneren dann auch nicht mehr auf.
Dass Clara Schumann weit mehr ist als die Frau an Robert Schumanns Seite weiß die interessierte Musikwelt spätestens seit 2019, dem Jubiläumsjahr ihres 200. Geburtstags und den damaligen zahlreichen Unternehmungen, das Leben dieser bemerkenswerten Künstlerin nachzuzeichnen. Bedauerlich, dass hier jetzt längst überholte und anhand der Quellen widerlegte Klischees wieder ausgegraben werden.
Viele Exponate und an belegbaren Fakten dargestellte Situationen im Düsseldorfer Schumann-Haus berichten offenbar von einem ganz anderen Künstlerpaar. Dort finden die Besucher jedenfalls ein anderes „Storytelling“, wie es die Autorin bezeichnet.
Die eigenwillige, wohl als „modern“ gelten sollende Sprache der Autorin („Regretting Motherhood“, „toxische Beziehung“, „Work-Life-Balance“, „Working Mom“, „queer“, (um nur einige Begriffe zu nennen) setzt Denkmuster voraus, die im 19. Jahrhundert (noch) nicht existierten, weshalb sich auch Zusammenhänge und Ereignisse aus dieser Zeit nur schlecht damit beschreiben, geschweige denn bewerten lassen.
Es ist schade, dass hier Persönlichkeiten angegriffen werden, die sich nicht mehr wehren können. Und nicht zuletzt fragt man sich: Warum eigentlich? Warum verwendet man für solche reißerischen Romane reale Personen?
Weitere Beispiele:
- Es tut fast schon weh, wenn Clara Schumann, die unter ihren Fehlgeburten nachweislich sehr gelitten hat (siehe u.a. Briefedition), diese als bewusst herbeigeführte Schwangerschaftsabbrüche unterstellt werden.
- Wo lässt sich nachweisen, dass Clara Schumann nach ihrer Heirat „auf Geheiß des Gatten hochgeschlossene dunkle Kleider und ein sittsames Häubchen“ tragen musste, wie die Autorin gleich auf der ersten Seite ihres Buches verrät? Die zahlreichen Bilder der Pianistin zeigen dies nicht. Die von ihr freiwillig getragenen dunklen Kleider und den schwarzen Witwenschleier findet man – wie der Name schon sagt – erst nach Schumanns Ableben.
- Als seltsame Erklärung für diese ominösen „Spitzenhäubchen“ schreibt Frau Eichel: „Folgsam trägt sie das weiße Spitzenhäubchen, das ebenso der Domestizierung dient wie Roberts Lob nach einem Diner im Hause Schumann, Clara schicke sich „ganz reizend zur Wirtin an'“
- Die „Domestizierung“ von Clara Schumann klingt fast, als sei sie ein Haustier…
Dieses Diner war das erste in der ersten Leipziger Wohnung kurz nach der Hochzeit, wo Clara unendlich nervös war, wovon sie ausführlich im Ehetagebuch berichtet. Sehr dankbar war sie ihrem Robert für das von Frau Eichel zitierte Lob, mit dem er sie aufrichten und ihre Ängste zerstreuen wollte.
Und zum anderen hier dieses Buchzitat als echte Krönung:
- Eichel Seite 449: „Bei einer anderen Gelegenheit – wieder tut sie ihm den Gefallen, etwas von ihm aufzuführen, diesmal im privaten Kreis – springt er wutentbrannt auf und schreit: ‚Höre auf, Clara, so spielt man nicht Schumann!‘ Danach schlägt er ihr in Anwesenheit der entsetzten Zuhörer den Klavierdeckel auf die Finger“.
Wird diese „Szene“ in irgendeinem Brief erwähnt, gibt es irgendeine belegbare Verlautbarung z.B. der „entsetzten Zuhörer“?
- Alkoholsucht hat schon Clara Schumanns Vater Friedrich Wieck dem als Schwiegersohn ungeliebten Robert angedichtet. Er scheiterte damit vor dem Leipziger Appellationsgericht. Wenn man in der Lage ist, die „Hinweise“ in den Quellen richtig zu lesen, erkennt man nicht nur dieses Fehlurteil, sondern auch jenes über Schumanns angebliche homosexuellen Neigungen und seine queere Attitüde.
Glücklicherweise hat Clara Schumann nicht, wie im 19. Jahrhundert üblich, ihre Karriere als Konzertpianistin mitsamt der öffentlichen Aufritte nach ihrer Heirat beendet und glücklicherweise hat ihr Mann sie immer wieder zum Komponieren ermuntert. Diesem Umstand verdanken wir heute viele wertvolle Zeugnisse dieses einzigartigen Künstlerpaares, die wir sehen, hören und erleben dürfen.
Man muss nicht den einen gegen den anderen auf- oder abwerten. Clara und Robert Schumann galten und gelten beide gleichermaßen, damals schon und heute erst recht!
Ein Wort zum Buchtitel: Clara Schumann pflegte eine gesunde Distanz und legte Wert auf geschliffene Umgangsformen (siehe auch die Briefe über die Düsseldorfer Damen bzw. das „Rheinische Leben“). Mit dem Duzen war sie sehr zurückhaltend und gestattete es so gut wie niemandem. Ein Buch über sie mit dem Titel „CLARA“ hätte sie als anbiedernd empfunden und mit spitzen Fingern sofort weggelegt…
Die von mir aufgezeigten und hoffentlich korrekten Feststellungen gehen nach meiner Auffassung in eine Richtung, in der sich die Schumann-Forschung schon einmal befand als über Jahrzehnte immer mal wieder das „Gerücht“ verbreitet wurde, „Sohn Felix ist von Johannes Brahms“. Das war ja mal wirklich eine reißerische Nachricht. Den ernstzunehmenden Schumann-Forscherinnen und -Forschern gelang zwar der Gegenbeweis, trotzdem mussten sie sich mit diesem Bild über Jahrzehnte herumschlagen.
Ganz sicher war das Leben mit Robert Schumann nicht einfach, denn Roberts Erziehungsmuster entstammten dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Schaue ich aber in viele Briefe von Clara, die teilweise auch in Düsseldorf geschrieben wurden und gerade nach dem 24.2.1854 an Joseph Joachim gingen, meine ich eine tiefe Liebe und Zuneigung – bei allen Schwierigkeiten des damaligen realen Lebens – zu „Ihrem Robert“ feststellen zu dürfen.
Unverständlich bleibt mir bei Frau Eichels „Domestizierungs-Ansatz“ der unbedingte Wille, dem damaligen Leben im 19. Jahrhundert unseren heutigen Maßstab aufzudrücken und deshalb dieses Leben Clara Schumanns mit ihrem Ehemann Robert Schumann sozusagen durchgängig negativ zu bewerten.
Wir sollten uns freuen, dass wir uns über die Jahrhunderte weiterentwickelt haben und sollten uns mehr der künstlerischen Leistung des Musikerpaares zuwenden und versuchen, diesen wunderbaren musikalischen Schatz, uns von Robert und Clara geschenkt, zu genießen.
gez. Manfred Hill - Ehrenvorsitzender-
am 16.1.2025 – 12.00 Uhr
Kommentare zu dieser Veröffentlichung kamen sehr spontan und sehr schnell. Eine kleine Auswahl dieser Kommentare finden Sie nachfolgend in anonymisierter Form:
21.1.2025:
Zum Hill-Kommentar: er spricht mir aus der (Schumann-)Seele. Ich war ganz entsetzt, als ich in SWR Kultur ein Interview mit der unsäglichen Autorin damals zum Erscheinen des Buches gehört habe. Eigentlich darf man diesem Machwerk keine Aufmerksamkeit schenken, und kaufen tue ich es sowieso nicht.
Herzlich W.S.
16.1.2025
Lieber Herr Hill,
vielen Dank für die Weiterleitung Ihrer Anmerkungen.
Ich teile Ihre Ansichten zu 100 Prozent und finde die unsägliche Diktion von Christine Eichel so wie ihr unseriöses Geschreibsel ganz furchtbar! Das ist TikTok- Niveau und angesichts dieses außerordentlichen Künstlerpaares vollkommen unangemessen und respektlos.
Mit besten Grüßen
G.L.
17.1.2025
Lieber Herr Hill,
ich habe den Artikel in der RP über die Neuerscheinung gelesen und diese zunächst als Ankündigung eines interessanten Buches verstanden mit der Überlegung, mir dieses zu kaufen. Ohne einen Zusammenhang zu ahnen, fand ich dann Ihre Mail in meinem Postfach, die mich zunächst überraschte, mit zunehmendem Lesen aber immer mehr erstaunte und interessierte.
Jetzt, da ich Ihren Text gelesen habe, möchte ich Ihnen meinen Dank aussprechen für diese ausführliche Darstellung und ich ziehe nicht zum ersten Mal den Hut vor Ihrem Engagement. Ich bin sehr beeindruckt von Ihren Ausführungen und halte sie für sehr wichtig, lerne gern von Ihnen, der sehr viel mehr im Thema steht als ich es tue, und freue mich über die Aufklärung.
Wenn es auch nur sehr wenige Gelegenheiten gibt, bei denen wir uns persönlich begegnen, fühle ich mich Ihnen verbunden durch Themen, die in Ihren Ausführungen mit anklingen: die Frage danach, wie wir mit Sprache umgehen. Das Recht, das wir uns heute herausnehmen, viele Dinge zu beurteilen ohne Rücksicht auf gesellschaftliche Verhältnisse und das Zusammenleben der Menschen mit ihren Werten und Regeln in einer anderen Zeit.
Hoffentlich erreichen Sie viele Menschen mit Ihren Darlegungen, können hoffentlich Viele überzeugen oder zumindest zu kritischem Lesen anregen, bei mir ist es Ihnen gelungen.
In diesem Sinnen wünsche ich Ihrer Initiative alle Aufmerksamkeit, die sie haben sollte, und sende Ihnen sehr herzliche Grüße
P.Z.
16.1.2025
Bravo, lieber Herr Hill! Eine solche Rezension würde es verdienen, in der FAZ veröffentlicht zu werden. Ich bin Ihnen sehr dankbar.
Ihr
M.R.
16.1.2025
Endlich ist der Innere Protest-Druck raus, der sich beim Lesen des RP-Artikels unwillkürlich aufgebaut hat.
Wir stimmen Manfred Hill, dessen Haltung und Verdienst ich seit Jahren kenne und schätze, vollkommen zu.
C.H.
16.1.2025:
Verehrter Herr Hill,
ich stimme Ihnen voll umfänglich zu. Danke für Ihre berechtigt-kritischen Bemerkungen.
Natürlich erwarb ich dieses Buch direkt nach Erscheinen: Beispielsweise die Monographie von Frau Dr. Knechtges-Obrecht über Clara Schumann wurde nicht berücksichtigt und v. a. m.
Zunächst wollte ich viele Thesen widerlegen. Allein andere ExpertInnen der Forschungscommunity sind dringend aufgerufen und in der unbedingten Pflicht, dies zu tun.
Beste Grüße sendet
R.W.
16.1.2025
Lieber Herr Hill,
da ich eben im Zug sitze, konnte ich Ihre Mail nicht nur gleich lesen, sondern will auch postwendend darauf antworten. Was soll ich sagen: Ich stimme jeder Zeile, die Sie geschrieben haben, uneingeschränkt zu. Wir haben es hier mit zeittendenziöser Publizistik zu tun. Derartige Veröffentlichungen entfachen stets Strohfeuer journalistischer Begeisterung, auch wenn sich ihr Neuigkeitsgehalt und ihre Seriösität in Grenzen halten. Ich kenne das aus verschiedenen Zusammenhängen (z. B. zur sexuellen Orientierung von Komponisten, zur Stellung von Ehefrauen berühmter Komponisten u. a.), ohne je verstanden zu haben, worin hier - außer Sensationsgier und Geschäftemacherei - das Interesse besteht. Sie haben also Recht, sich mit Ihrer Autorität zu Wort zu melden, und Sie tun das wohltuend ruhig und sachlich, was Ihrer Einlassung Gewicht verleiht. Vielleicht hört ja sogar der ein oder andere auf Ihre besonnene Stimme, was zu wünschen wäre.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr U.K.
16.1.2025
Lieber Herr Hill,
haben Sie vielen Dank für Ihre so detaillierten, engagierten und sicherlich zu Recht besorgten Anmerkungen zu Christine Eichels Buch. Ich habe es nicht gelesen und werde es bestimmt auch nicht tun – habe auch von anderer Seite nichts Gutes darüber gehört. All dessen Mängel zu benennen, Fehlurteile darin zu widerlegen oder auch nur unzutreffende Formulierungen als solche zu brandmarken, wie Sie es ansatzweise getan haben, wäre eine ziemliche Zumutung, der sich zu stellen bei diesem „Werk“ nicht lohnen dürfte.
Frau Dr.(!) Eichel ist ja wohl in erster Linie Journalistin, was bereits Vieles erklärt. Ihr Buch – was will es eigentlich sein, Sachbuch, Biographie, Roman? - gehört wohl am ehesten in die Kategorie „Literatur, die die Welt nicht braucht“.
Insofern nochmals Dank für Ihre Ausführungen!
Mit besten Grüßen
F.L.
16.1.2025:
Lieber Herr Hill,
wie wunderbar, dass Sie sich diese Arbeit machen! Ich war sehr verblüfft, dass WG sich zu solch für ihn ungewohntem Lob aufgeschwungen hat, wo er doch sonst immer das Haar in der Suppe findet, und das Buch von Eva Weisweilier, das ja vor 40(?) 45(?) Jahren herausgekommen ist, und das eine ähnliche Tendenz aufzeigt, nicht mal erwähnt.
Ihre I.S.
16.1.2025
Lieber Herr Hill,
vielen Dank für Ihre Nachricht. Die C. Schumann-Biographie von Christine Eichel ist ein Ärgernis, aber nicht das erste, das die Autorin produziert (ihre pünktlich zum Beethoven-Jahr erschienene Beethoven-Biographie mit dem Titel „Der empfindsame Titan“ gehörte auch schon dazu). Leider ist es auch nicht das erste Mal, das in Populärwissenschaftskreisen und in der Öffentlichkeit ein reißerisches Buch gelobt (bzw., um es in Eichels Jargon zu formulieren, „gehypt“) wird, das jegliche wissenschaftlichen Kriterien nicht nur unterwandert, sondern systematisch ignoriert. Das unlängst durch (fast) alle Medien gepriesene Buch „250 Komponistinnen“ von Arno Lücker ist ein prominenter Parallelfall aus jüngster Zeit. Seien Sie versichert, dass ich Ihre Verärgerung und Besorgnis vollauf teile – und zugleich versuche, gelassen zu bleiben. Eine geharnischte Reaktion aus der Fachwelt würde aus meiner Sicht das Elaborat von Frau Eichel unverhältnismäßig ernst nehmen.
In diesem Sinne mit vollem Verständnis und ebenso herzlichen Grüßen
G.B.
17.1.2025:
Hier auch eine von vielen Kommentaren an die Clara-Schumann-Initiative, die meine Stellungnahme weiterleitete:
DANKESCHÖN!
Ich lese zur Zeit das Buch „Clara“.
Offensichtlich ist, dass es sich um ein Buch handelt, das aus heutiger (einseitiger) feministischer Sicht geschrieben ist.
Fatal aber ist, dass die angeblich „neuen Quellen“ wohl nicht die Vorwürfe im Buch gegen Robert Schumann -insbesondere die ständigen homosexuellen Seitensprünge- rechtfertigen.
Das Buch habe ich auf Empfehlung von Wolfram Goertz (RP) im neuen Jahr gekauft. Zwar bin ich bei Empfehlungen von Wolfram Goertz skeptisch, seitdem ich auf seine Empfehlung zur mittelmäßigen (mit untragbaren rhythmischen Fehlern im „Grave“ der Pathetique) Gesamteinspielung der Klaviersonaten von Beethoven durch Igor Levit hereingefallen bin. Aber dass Goertz euphorisch die neue Biografie als Referenzbiografie empfiehlt, obwohl Ihre Biografie von 2019 auf neuestem wissenschaftlichem Stand ist, ist mehr als bedenklich.
Kann die „Clara Schumann- Initiative“ oder der Robert Schumann Verein nicht eine Podiumsdiskussion zwischen Ihnen und Wolfram Goertz initiieren?
Auf jeden Fall wäre ich daran interessiert, eine wissenschaftlich fundierte Stellungnahme von Ihnen oder einem anderen „Kenner“ der Eheleute Schumann zu lesen. Das Buch von Eichel fordert Sie ohnehin heraus, da es Ihnen den abfälligen Vorwurf macht, Sie hätten zu Unrecht in Ihrer Biografie in einer Überschrift die ersten Ehejahre als „glücklich“ bezeichnet.
Mit herzlichen Grüßen
V.H.
Manfred Hill - am 28.1.2025